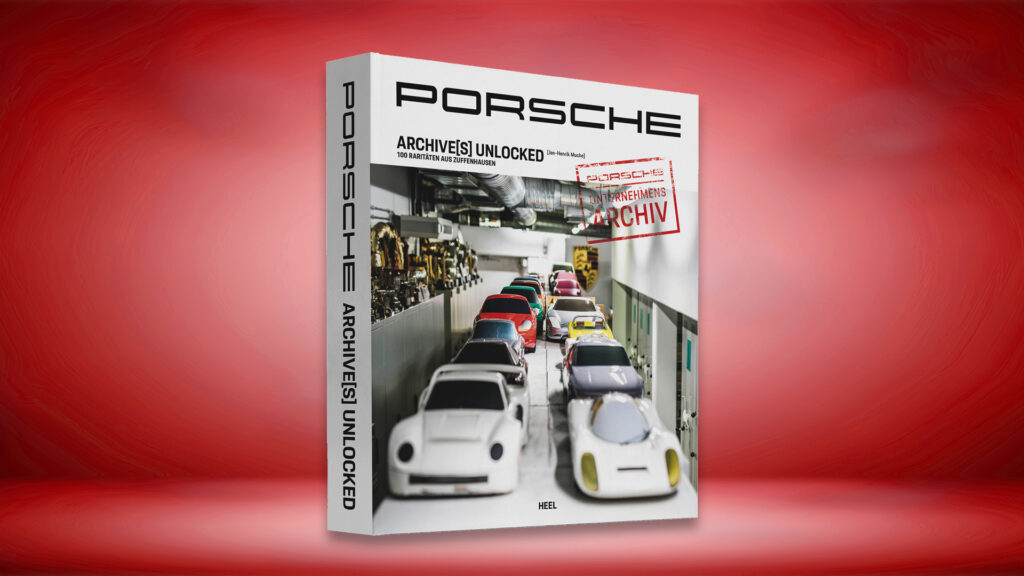Im Porsche 911 durch alle US-NationalparksOn the road
Von der KI generierte Bilder werden ja immer besser. Auf den ersten Blick sah das Foto von Jeff Rhoades' Elfer recht überzeugend aus, aber auf keinen Fall würde jemand mit einem 991 so wild driften, dass es aussieht wie auf dem Cover eines Rallye-Spiels. Das Dachzelt machte das Ganze noch unglaubwürdiger, ebenso wie die perfekt positionierten Berge im Hintergrund. Aber, Moment mal! War das alles etwa echt?