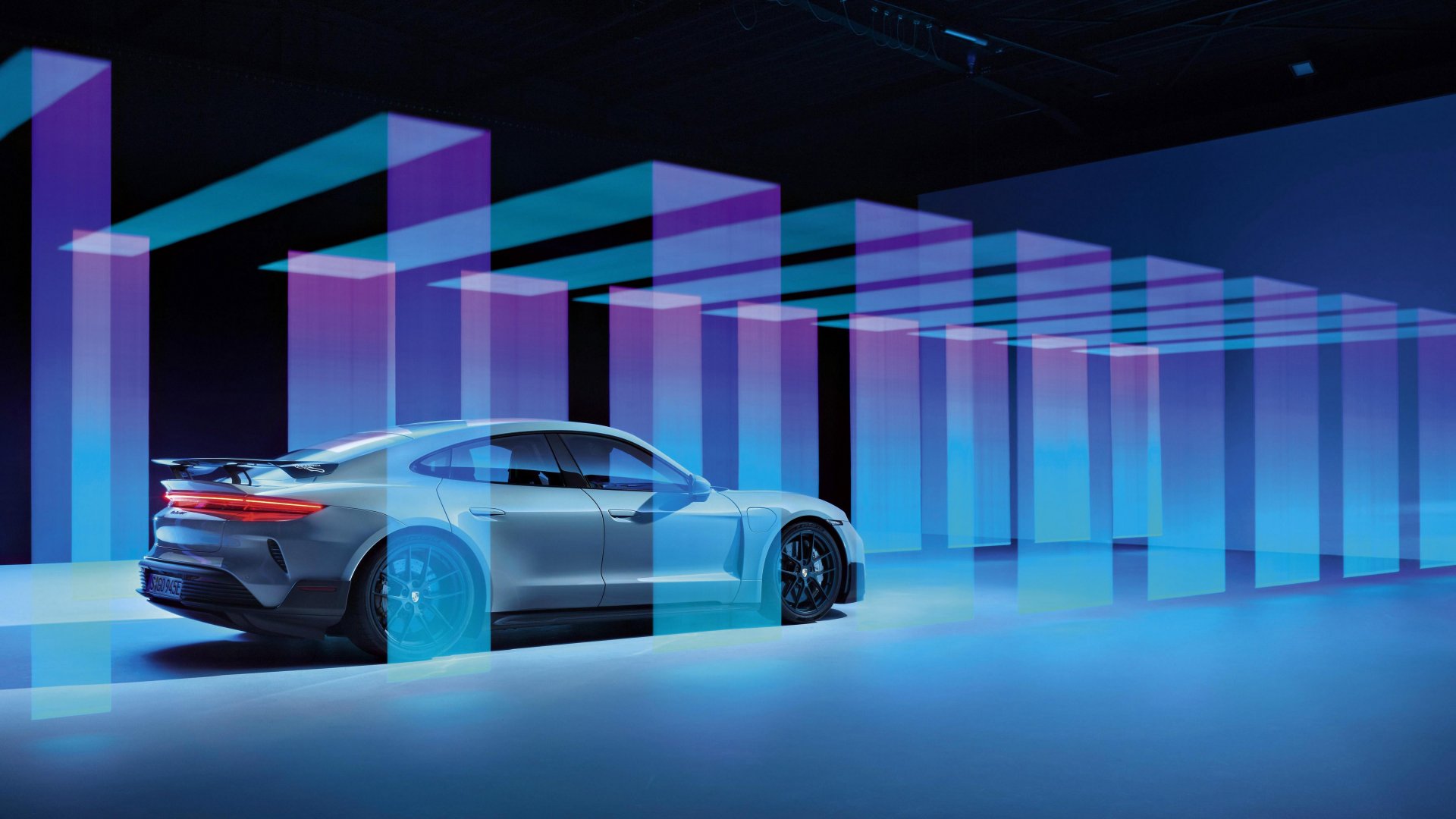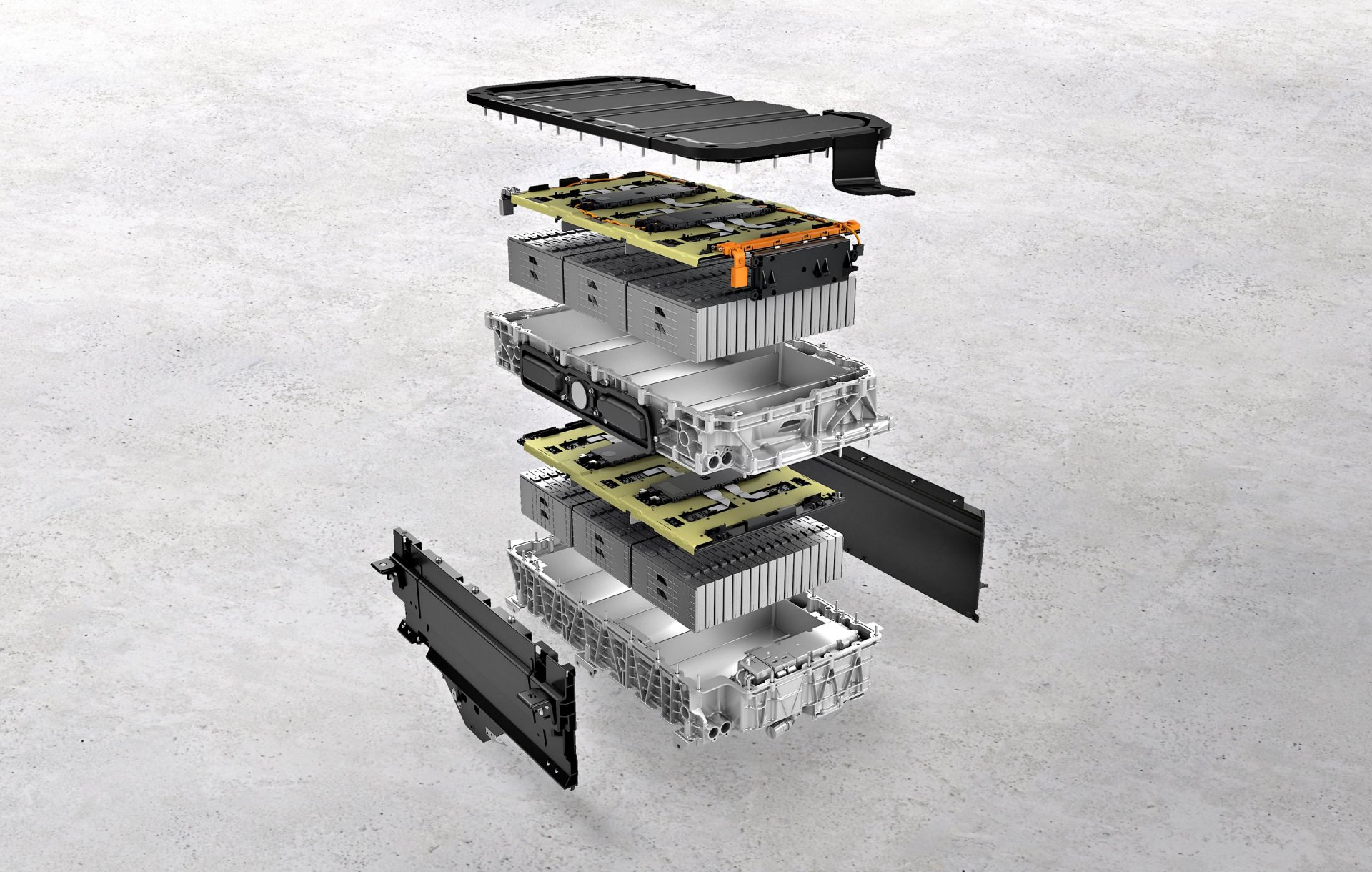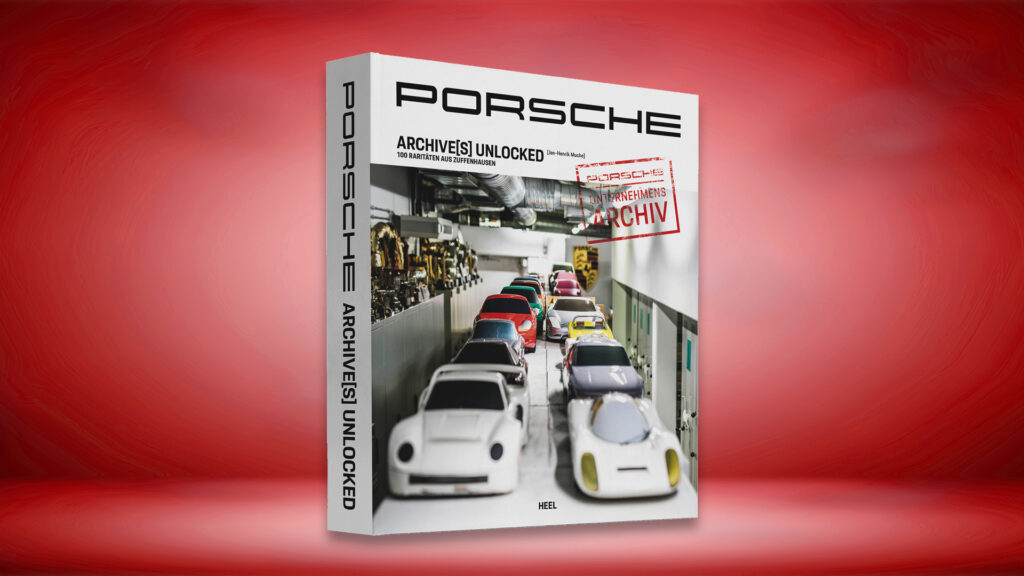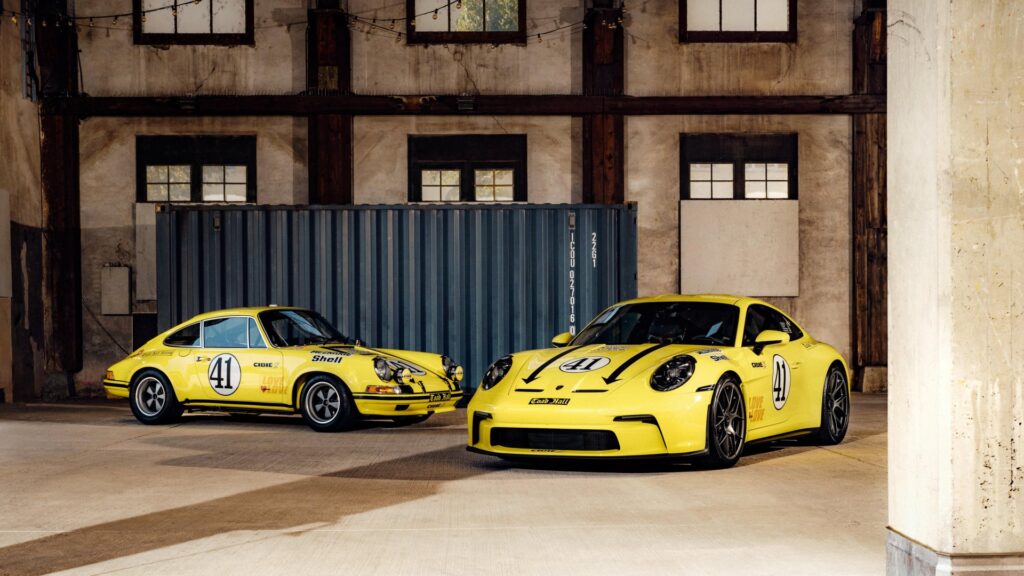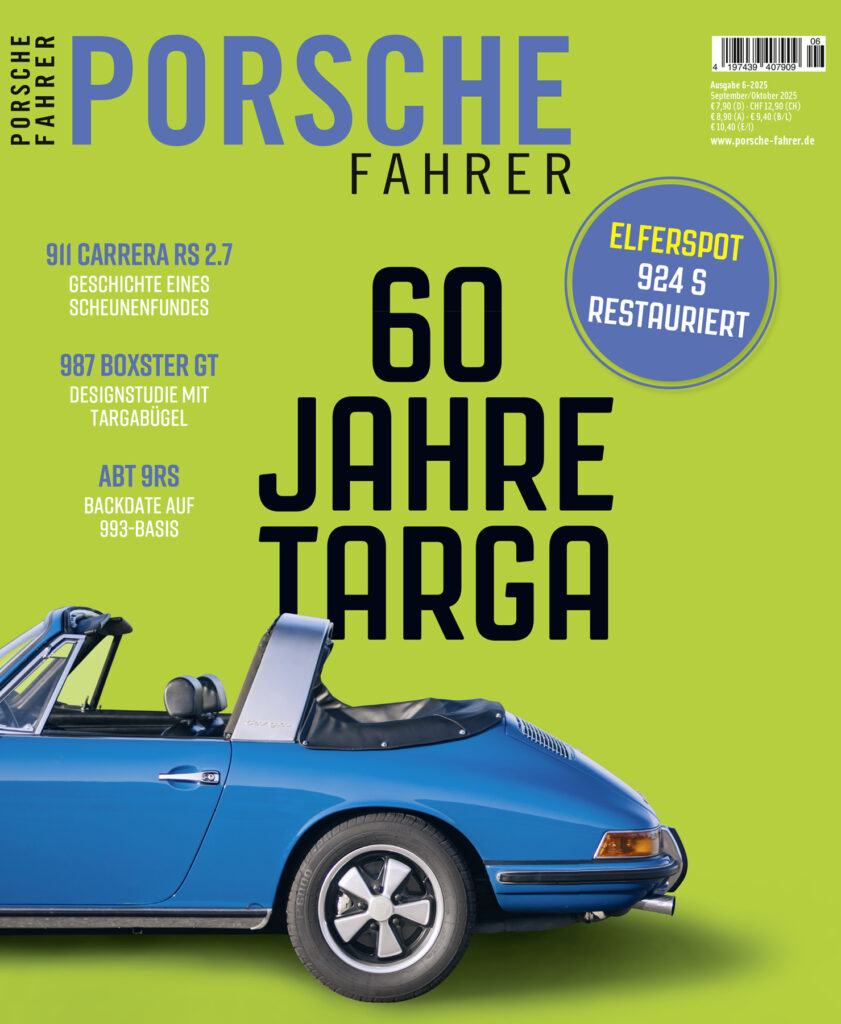Porsche 356 | Nr. 5006 lebt.Entdeckung einer Porsche-Legende
Fast sechs Jahrzehnte galt er als verschollen, nun erstrahlt er in neuem Glanz: der Porsche 356 mit der Fahrgestellnummer 5006, einer der ersten sieben Porsche Sportwagen aus Stuttgarter Produktion.